Am 14. Oktober 1986 fährt eine junge Kunstpädagogikstudentin zusammen mit ihrer Mutter in den U-Bahnhof Bockenheimer Warte ein. Von Westen kommend, sitzen beide in einem Wagen der gerade vor zwei Tagen neu eröffneten Linie U7. Nach dem Halt schaut Pagona Paul, so der Name der Studentin, kurz aus dem Fenster des Waggons auf die Bahnsteigwand – und blickt genau in ihr eigenes Gesicht.
Nachdem sie mit ihrer Mutter ausgestiegen ist und der Zug die Station verlassen hat, kann sie sich das Foto, auf dem sie zu sehen ist, genauer betrachten. Es ist eines unter insgesamt acht, die die eine Begrenzungsmauer des U-Bahnhofs säumen. Pagona Paul weiß auch sofort, wann und wo es entstanden ist: ein Jahr zuvor[1] in der Malklasse von Professor Willi H. Wirth in einem großen Atelierraum der sogenannten Kunstfabrik, dem damals vom Institut für Kunstpädagogik genutzten Backsteinbau der alten Dondorf’schen Druckerei.

Bei den Malklassen wurde den Studentinnen und Studenten jeweils ein Thema gestellt, das sie selbstständig bearbeiten sollten. Anhand der Übungen lernten sie, wie Bilder unter der Verwendung unterschiedlicher Farben entstehen, und eigneten sich verschiedene Techniken an. Professor Wirth lief während der Seminarstunden zwischen den Staffeleien hin und her, gab einzelnen Studentinnen und Studenten Tipps und nahm ihnen auch schon einmal den Pinsel aus der Hand, um ein angefangenes Werk zu korrigieren. Am Tag der Entstehung des Fotos hieß das Thema „Ausblicke“ bzw. „Fenster“– auf dem Foto ist zum Beispiel zu sehen, wie Ioannis Papagiannoulis (der Dritte von links) auf seiner Staffelei ein entsprechendes Motiv bearbeitet. Dass Barbara Klemm, deren Name ihnen damals noch kein Begriff war, in der wesentlich zahlreicher besetzten Malklasse zum Fotografieren vorbeischauen und ein Bild aus ihrem Seminar später in der Öffentlichkeit zu sehen sein würde, war den Kursteilnehmern zuvor angekündigt worden. Die sechs, die keine Bedenken hatten, abgelichtet zu werden, versammelten sich an einer Front des Seminarraums. Sie sollten sich direkt bei ihrer Arbeit porträtieren lassen, wobei die Szene, in der Pagona Paul (die Zweite von rechts) interessiert die Staffelei ihrer Kommilitonin betrachtet, von Barbara Klemm ein wenig arrangiert wurde. Anschließend war man unter den Porträtierten gespannt, welche Aufnahme wohl für den U-Bahnhof ausgewählt werden würde.[2] Alle Interviewpartner, die wir auf dem Foto identifiziert haben und mit denen wir Gespräche führten, äußerten, es sei für sie bedeutsam, dass das Foto weiterhin an der Bockenheimer Warte zu sehen sei – nicht nur als persönliches Erinnerungsstück, sondern auch als historisches Dokument einer Phase der Universitätsgeschichte, die mit dem Umzug der Hochschule ins Westend und dem Auszug des Instituts für Kunstpädagogik aus der Kunstfabrik im Sommer 2022 zu Ende gegangen sei. Die Aufnahme wird übrigens auch bei anderen (lokalhistorischen) Forschungen oder im Rahmen wissenschaftlicher Projekte gern für die Dokumentation benutzt: zum Beispiel in der Broschüre unseres Stadtteilhistoriker-Kollegen Friedhelm Buchholz zur Geschichte der Alte(n) Druckerei Dondorf[3] oder in einer ebenfalls als Broschüre erschienenen Arbeit für eine Modulprüfung im Schwerpunkt Malerei der Kunstpädagogikstudentin Talida Hölting[4].
Vier der fünf Porträtierten, die wir ausfindig machen konnten, arbeiten heute (zum Zeitpunkt der Gespräche mit ihnen 2023/24) als (Kunst-)Pädagogen – in den Praunheimer Werkstätten, verschiedenen (freien) Schulen oder als (Deutsch-)Lehrer in Griechenland. Dabei verlief ihre berufliche Karriere nicht immer geradlinig, nur eine unserer Interviewpartnerinnen fand sofort eine Arbeitsstelle, auf der sie heute noch tätig ist. Der (inzwischen wieder abgeschaffte) Magister-Abschluss, mit dem sie Anfang der 1990er Jahre die Universität verließen, erhöhte für die übrigen nicht gerade ihre anfänglichen Berufschancen; eine Interviewpartnerin musste ihre Vorstellung von einer Stelle als Museumspädagogin irgendwann komplett aufgeben und fand ihr Auskommen schließlich in der Tourismusbranche. Alle bis auf eine waren 2023/24 auch noch selbst künstlerisch aktiv: als Fotografin, als Malerinnen mit eigenem Studio oder als Designer von Kleidern und Kostümen aus recyceltem Material. Drei aus der Gruppe, die sich in der Malklasse kennengelernt hatten, halten bis heute Kontakt, zwei davon nehmen sporadisch an den Treffen der Alumni-Initiative des Instituts für Kunstpädagogik[5] teil. Erwähnenswert für den damaligen historischen Kontext ist sicher die Tatsache, dass alle fünf, deren Namen wir ermitteln konnten, aus Einwandererfamilien stammen: zwei haben italienische, zwei griechische Eltern und eine Studentin einen iranischen Vater.

Das Gebäude der alten Dondorf’schen Druckerei im Jahr 2023
Zur Geschichte der Dondorf’schen Druckerei, in der das Foto 1985 entstanden ist, existiert mit Friedhelm Buchholz’ Broschüre ein wertvolles Zeugnis, das für die von ihm beschriebenen Epochen keinerlei Ergänzungen bedarf. Die dritte (aktualisierte) Auflage mit Stand Ostern 2023 dokumentiert bereits die Entwicklungen nach dem Umzug der Kunstpädagogen auf den Westend-Campus im Jahr 2022, die zwischenzeitlichen Pläne für die Nutzung durch das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, die Ankündigung des Abrisses und die sich abzeichnende Opposition dagegen[6]. Diese Opposition weitete sich nach dem Erscheinen der Printbroschüre im Verlauf des Jahres 2023 aus und fand ihren Niederschlag in vielfältigen Plädoyers für den Erhalt des Gebäudes (siehe etwa die abgebildete Stellungnahme des Frankfurter Vereins für Frankfurter Arbeitergeschichte) und in weiteren Protesten[7].
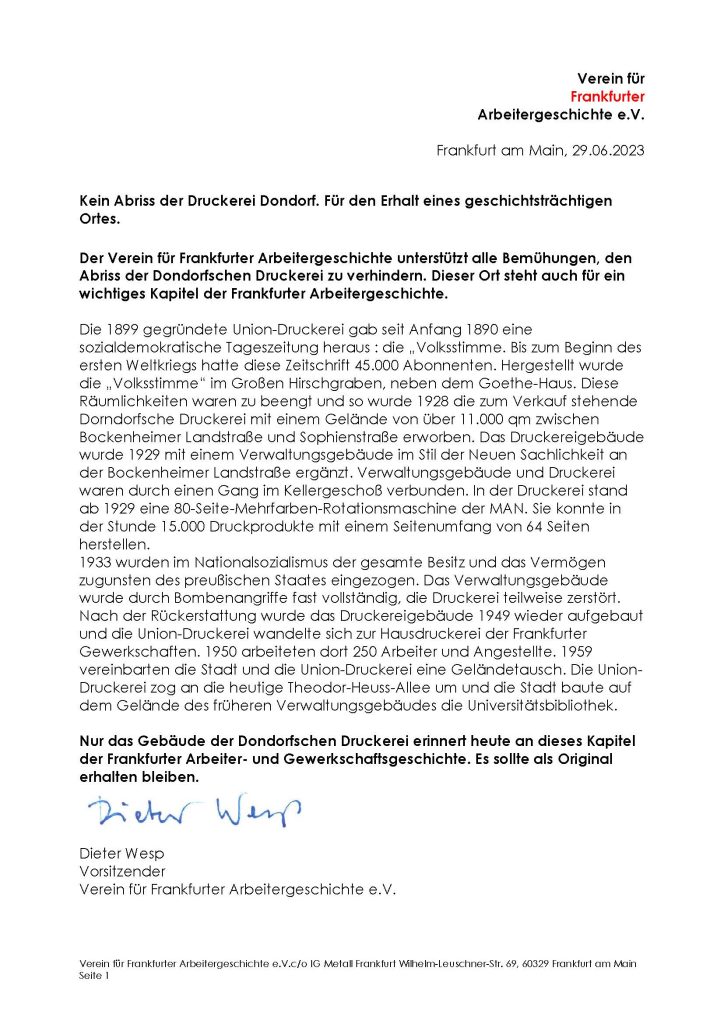
Schließlich wurde es am 24. Juni erstmals von einer Gruppe von Aktivisten, die eine Aussetzung der Abrisspläne und die Nutzung der alten Fabrik als Kulturzentrum forderten, besetzt.[8] Nach der Räumung im Juli[9] kam es im Dezember 2023 zu einer zweiten Besetzung[10], die am 19. des Monats durch die Frankfurter Polizei beendet wurde[11]. Die (vorläufig) letzte Station in der wechselvollen Geschichte der alten Kunstfabrik: die Entscheidung, sie der von Renovierungsmaßnahmen betroffenen Kunsthalle Schirn für drei Jahre als Ausweichquartier zur Verfügung zu stellen.[12]
Etwas ausführlicher beschrieben wird die Geschichte des Konflikts um die Dondorf’sche Druckerei hier, weil eine interessante Beziehung zu einem anderen Foto aus dem U-Bahnhof Bockenheimer Warte besteht. Die Leitung der Universität – formell noch Eigentümerin des Gebäudes, das aber bald in andere Hände übergehen sollte – fühlte sich in ihrer Rolle, die sie in den Auseinandersetzungen um das alte Druckereigebäude spielen musste, augenscheinlich nicht wohl: Sie musste u.a. mit den Besetzern verhandeln. Daher schaltete sie für die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit einen Experten ein. Dabei handelte es sich um den Chef einer nicht zuletzt auf die sogenannte Krisenkommunikation spezialisierten PR-Agentur. Dieser Kommunikationsexperte war Rupert Ahrens – 1982 Vorsitzender des Sponti-AStA, der damals zum Besuch der Veranstaltung mit Alfred Dregger aufgerufen hatte und unter den jubelnden Studentinnen und Studenten aus dem H VI zu erkennen ist.
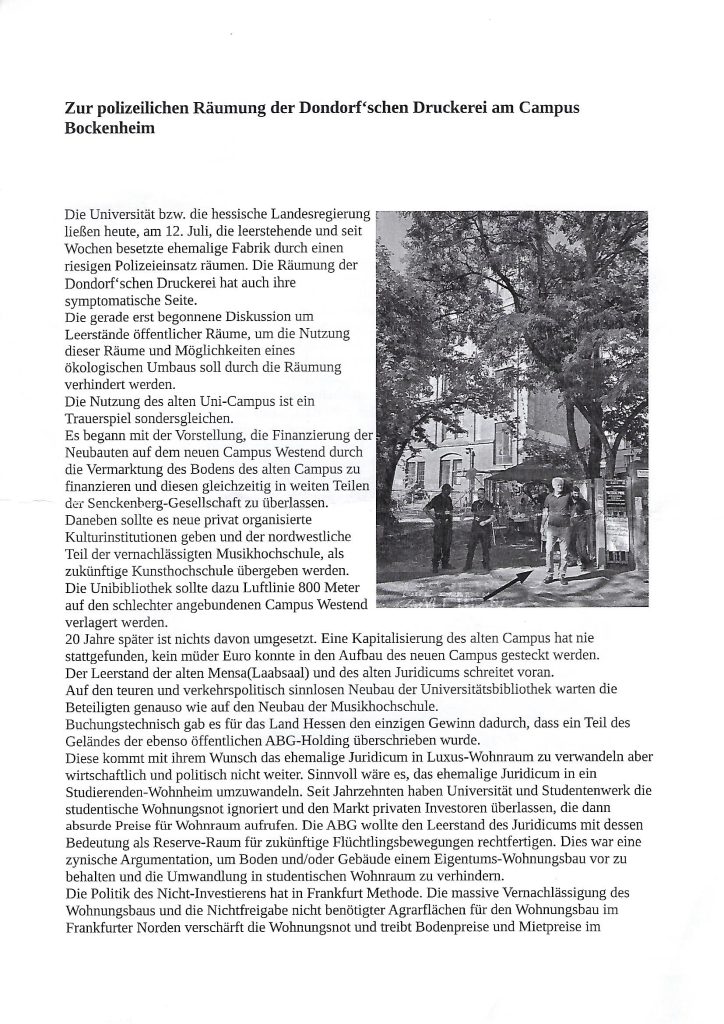
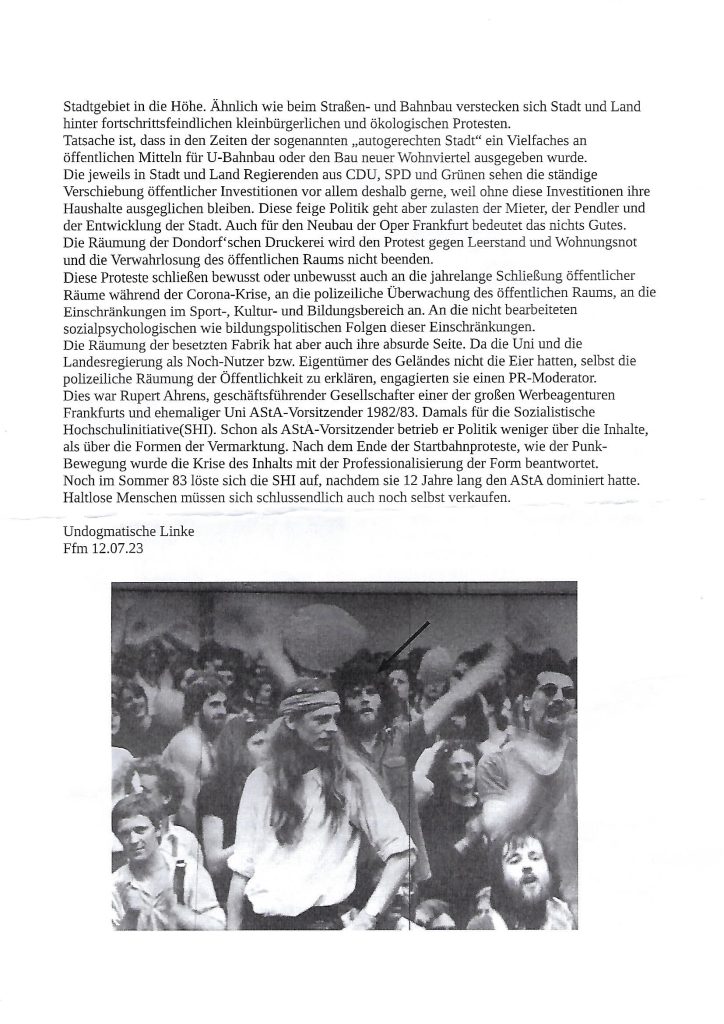
Seine Agentur war schon in der Vergangenheit für die Universitätsleitung tätig gewesen, außerdem verfügte er seinen eigenen Worten zufolge noch aus seiner Frankfurter Zeit über gute Kontakte zu den hiesigen Ordnungsbehörden.[13] Obwohl die Hochschule anfänglich Wohlwollen gegenüber den Vorstellungen der Besetzer zu signalisieren schien[14], zeigten diese nach der ersten Räumung für ihr Gegenüber naturgemäß kein Verständnis und kritisierten in aller Schärfe nicht nur Polizei und Universitätsleitung – sondern auch den Krisenkommunikator. Ergebnis war u.a. ein in Universität und Stadt verteiltes Flugblatt (s. Abbildung). Es geriet am Ende zu einer vermeintlichen Abrechnung der Rebellen des Jahres 2023 mit dem Sponti des Jahres 1982.
[1] Die Erinnerungen sämtlicher Interviewpartner, die die Stadtteil-Historiker auf dem Foto identifizieren konnten, lassen keine genauere Datierung als das Jahr 1985 zu. Für eine unserer Gesprächspartnerinnen war der Bezugspunkt „vor Tschernobyl“ – der Unfall in dem sowjetischen Atomreaktor fand am 28. April 1986 statt. Eine zweite der damaligen Kunstpädagogikstudentinnen hatte gerade 1985 mit dem Studium begonnen – der Kurs bei Prof. Wirth war eine der ersten Veranstaltungen, die sie belegt hatte. Pagona Paul wies bei unserem Interview auf die Beobachtung hin, es müsse am Tag der Aufnahme in der Kunstfabrik „recht frisch“ gewesen sein, da sie und einige Kommilitoninnen Pullover trugen, in einem Raum, in dem es ansonsten schnell sehr heiß und drückend werden konnte. Das spricht für ein Wintersemester. Einig waren sich außerdem alle Interviewten, dass es sich um eine Aufnahme aus einem Kurs bei Prof. Wirth handelte. Die Vorlesungsverzeichnisse der Goethe-Universität für das Wintersemester 1984/85 und das Sommersemester 1985 weisen keine entsprechenden Veranstaltungen aus. Im Wintersemester 1985/86 fanden zwei Übungen unter der Leitung von Prof. Wirth statt, die infrage kommen: montags (erstmals am 21.10.1985) eine „Offene Werkstatt“ zur „Erarbeitung technischer Verfahren“ und donnerstags (Beginn am 24.10.) „Farbe in Verbindung mit versch. Medien – Experiment u. fachwiss. Bezug“ (vgl. https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11089/file/1985_wv.pdf, Zugriff am 23.4.2024). Laut den Aufzeichnungen von Barbara Klemm stammt das Foto vom November 1985.
[2] Mündlicher Bericht Christina Artiano vom 12.5.2023 und Pagona Paul vom 7.3.2024; beide sind auf dem Foto zu sehen.
[3] Friedhelm Buchholz, Alte Druckerei Dondorf. Die wechselvolle Geschichte eines Industriedenkmals, 3. Auflage 2023, S. 53.
[4] Talida Hölting, Stein und Papier. Eine Forschungsbewegung durch den Raum, Frankfurt a. M. 2022, ohne Pagina.
[5] Vgl. alumni-initiative-kunstpaedagogik.blogspot.com, Zugriff 2.5.2024.
[6] Vgl. ergänzend https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/druckerei-dondorf-in-bockenheim-wird-doch-abgerissen-18618214.html, Zugriff 2.5.2024.
[7] Vgl. etwa Alexander Jürgs, Die Aufträge kamen sogar aus Japan, FAZ Rhein-Main vom 15.8.2023, S. 3.
[8] Vgl. https://www.fr.de/frankfurt/besetzte-dondorf-druckerei-in-frankfurt-der-kampf-geht-weiter-92372878.html, Zugriff 2.5.2024.
[9] Vgl. FAZ Rhein-Main vom 13.7.2023, S. 1.
[10] Vgl. https://www.hessenschau.de/panorama/demonstranten-besetzen-erneut-ehemalige-dondorf-druckerei-in-frankfurt-v5,kurz-dondorf-druckerei-100.html, https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-dondorf-druckerei-erneut-besetzt-polizei-beginnt-mit-raeumung-92720376.html, Zugriff 2.5.2024.
[11] Vgl. https://www.fr.de/frankfurt/die-party-auf-der-druckerei-ist-vorerst-vorbei-92737538.html, Zugriff 2.5.2024.
[12] Vgl. FAZ Rhein-Main vom 8.6.2024.
[13] Mündlicher Bericht Rupert Ahrens vom 6.3.2024.
[14] „Die Universität hat weiterhin Verständnis für die Forderung nach Freiraum für unabhängige Kulturinitiativen und Künstlergruppen. Die Ausgestaltung des (sub-)kulturellen Raums in Frankfurt ist jedoch Aufgabe der Stadt und liegt nicht in der Hand der Universität. Auch die Anliegen des nachhaltigen Bauens und des angemessenen Gedenkens werden von uns unterstützt; hier ist die Universität bei Bedarf bereit, den Prozess konstruktiv zu begleiten …“; https://aktuelles.uni-frankfurt.de/aktuelles/goethe-universitaet-fordert-kollektiv-die-druckerei-erneut-zum-ende-der-besetzung-auf/, Zugriff 2.5.2024.