Über Jahre war der Raum 4 des einstigen Philosophischen Seminars der Goethe-Universität in der Dantestraße der Ort, an dem Generationen von Studentinnen und Studenten die Grundlagen der europäischen Geistesgeschichte nähergebracht wurden. Andreas Meier, der u. a. Philosophie in Frankfurt studierte, hat ihn etwa zum Schauplatz einer längeren Szene seines Romans „Die Universität“ gemacht.[1] Sie spielt freitagsnachmittags im Sommer in einem Seminar Karl-Otto Apels, der in den 1980er Jahren an diesem Tag in verschiedenen Semestern u. a. über Wittgenstein, Husserl, Rawls, Aristoteles und Hegel referieren und diskutieren ließ.[2]
Ein wenig früher lag der Besuch Barbara Klemms im selben Raum beim Seminar Alfred Schmidts, dessen Vortrag sie mit der Kamera festgehalten hat: Er fand ihren Worten nach im Jahr 1979 statt, die Fotografin konnte den Stadtteil-Historikern leider nicht mehr sagen, aus welchem Anlass oder in welchem Auftrag.[3] Aus den Angaben Matthias Lutz-Bachmanns, der auf dem Foto links neben Schmidt zu sehen ist, lassen sich im Zusammenhang mit den Informationen aus den Vorlesungsverzeichnissen der Universität aber Schauplatz, Wochentag und Uhrzeit bestimmen. Lutz-Bachmann nannte uns selbst den Raum 4 als Ort, in der Seminarsitzung habe Nietzsches Schrift „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ im Mittelpunkt gestanden. Das aus den Baseler Jahren des Philosophen stammende Werk stelle, so Lutz-Bachmann, in der Auseinandersetzung mit Schopenhauer die Frage, welchen Sinn Geschichtswissenschaft gerade für junge Menschen habe.[4] Alfred Schmidt bot im Sommersemester 1979 eine Veranstaltung mit demselben Titel an, sie fand montags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr statt.[5]

Die mit geschweifter Klammer verbundenen Begriffe „Antiquarische / Kritische Historie“ hatte Lutz-Bachmann, damals wissenschaftlicher Assistent Schmidts, an die Tafel geschrieben. An den Tag, an dem das Foto aufgenommen wurde, konnte er sich gut erinnern. Seine Frau und er waren gerade dabei, eine neue Wohnung zu beziehen, in das Seminar kam er noch mit Farbspuren vom Renovieren an den Händen. Die Veranstaltung war, wie meist bei Alfred Schmidt, überfüllt, sie besaß eher „monologischen Vorlesungscharakter“ – mit der Möglichkeit zu Zwischenfragen. Für Schmidt war Lutz-Bachmann in seinen Vorträgen häufig der erste Ansprechpartner, der Professor wandte sich dann mit Formulierungen wie „Sie sind doch auch der Meinung, dass …“ an seinen Assistenten. Der Besuch Barbara Klemms war den Seminarteilnehmern vor Veranstaltungsbeginn angekündigt worden; sie suchte sich eine günstige Position im Raum und drückte etwa zwanzigmal auf den Auslöser. Dass das Foto in der U-Bahnstation hängt, erfuhr Lutz-Bachmann im Jahr 1986, als er der eigenen Erinnerung nach schon nicht mehr in Frankfurt war, durch einen Anruf eines Freundes: „Du bist dort neben einem älteren Herrn abgebildet.“ Bei seinem nächsten Besuch in der Stadt schaute er es sich näher an und ließ sich danebenstehend fotografieren. Heute, fast 40 Jahre nach Veröffentlichung, sind die Fotos an der Bockenheimer Warte für ihn trotz des fast beendeten Umzugs der Universität ins Westend und auf den Riedberg noch immer „am richtigen Platz“. Sie haben heute für ihn vornehmlich historische Bedeutung und dokumentarischen Wert: „Die Orte, das Arbeiten, die Mode waren damals anders.“ Es liege letztlich an der Stadt, ob sie das Stück Frankfurter und Universitätsgeschichte dort weiterhin zeigen wolle.[6]
Ähnlich wie bei seinem Kollegen Apel waren die Studentinnen und Studenten der Philosophie bei Alfred Schmidt gefordert, sich mit ganz verschiedenen Aspekten der europäischen Philosophiegeschichte auseinanderzusetzen. Im Semester seiner Nietzsche-Einführung im Sommer 1979 bot er außerdem eine Vorlesung über „Probleme des Materialismus“, ein Seminar zu „Hegels Naturphilosophie“ und ein weiteres zu „Kant: Transzendentale Deduktion“ an; ein Halbjahr zuvor hatte er u. a „Comte: Geist des Positivismus“ vorgestellt, in späteren Semestern standen neben einer Vorlesung zu Fragen der materialistischen Dialektik und Erkenntnistheorie Seminare über Feuerbach und Schelling, Freud und Bloch oder ein Kolloquium zum Historischen Materialismus im Spätwerk von Marx und Engels auf seinem Programm.[7] Im öffentlichen Diskurs der 1970er bis 1990er Jahre galt Schmidt als wichtigster Vertreter der Kritischen Theorie. Ein Porträt, das seinen Werdegang vom Studium der Philosophie in Frankfurt über seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent bei Horkheimer und Adorno, seine Berufung auf den Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie der Goethe-Universität in der Nachfolge von Max Horkheimer und Jürgen Habermas, die Zeit bis zu seiner Emeritierung 1999, sein wissenschaftliches Wirken danach, seine Beziehung zur Freimaurerei und seine wichtigsten Publikationen ausführlich vorstellt, findet sich im Frankfurter Personenlexikon.[8] Auch über seinen Tod im Jahr 2012 hinaus erschienen Bücher mit Texten von und über Alfred Schmidt, so z. B. im Jahr 2018 „Marx als Philosoph“. Das Schlusskapitel spricht über den Einfluss seiner Dissertation „Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx“ auf die Debatten innerhalb der Studentenbewegung der 1960er Jahre und über Schmidts Sicht auf die Revolte der Studenten. (Der Autor Helmut Reinicke kommt aber z. B. auch auf einen außergewöhnlichen Bockenheimer Buchladen innerhalb einer Drogerie zu sprechen, von dem Schmidt Teile seiner „esoterischen“ Lektüre bezog. Eine kleine Nebensache, die für die Stadtteil-Historiker nur dadurch interessant wurde, dass einer der Studenten, der auf dem Foto der jubelnden Menge anlässlich der Dregger-Rede zu sehen ist, Jahre später in dem Haus mit jener Drogerie wohnte, wo er immer noch auf das ausgesuchte Buchsortiment stieß. Dies stellte sich durch einen Zufall bei ihren Recherchen heraus.)[9]
Matthias Lutz-Bachmann ist nach seinen eigenen Worten „mit Mainwasser getauft“. 1952 in Frankfurt geboren, besuchte er das Lessinggymnasium und wurde später durch Alfred Schmidt motiviert, Philosophie zu studieren. Weitere Studienfächer waren katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaften, seine Studienorte Frankfurt und Münster. Im Sommersemester 1983 hielt der Assistent Schmidts sein erstes eigenes Seminar („Das Universalienproblem in d. Philosophie d. Antike, d. Mittelalters und der Neuzeit“) am Fachbereich Philosophie der Goethe-Universität.[10] Von 1989 bis 1994 war er Professor an der FU in Berlin, seit 1994 hatte er den Lehrstuhl in der Nachfolge Alfred Schmidts in Frankfurt inne. 1996 bis 1997 und 2007 bis 2009 Dekan des Fachbereichs Philosophie, nahm er von 2009 bis 2015 das Amt des Vizepräsidenten der Goethe-Universität wahr. Weitere akademische Stationen mit Lehraufträgen waren St. Louis, Tübingen und Bonn.
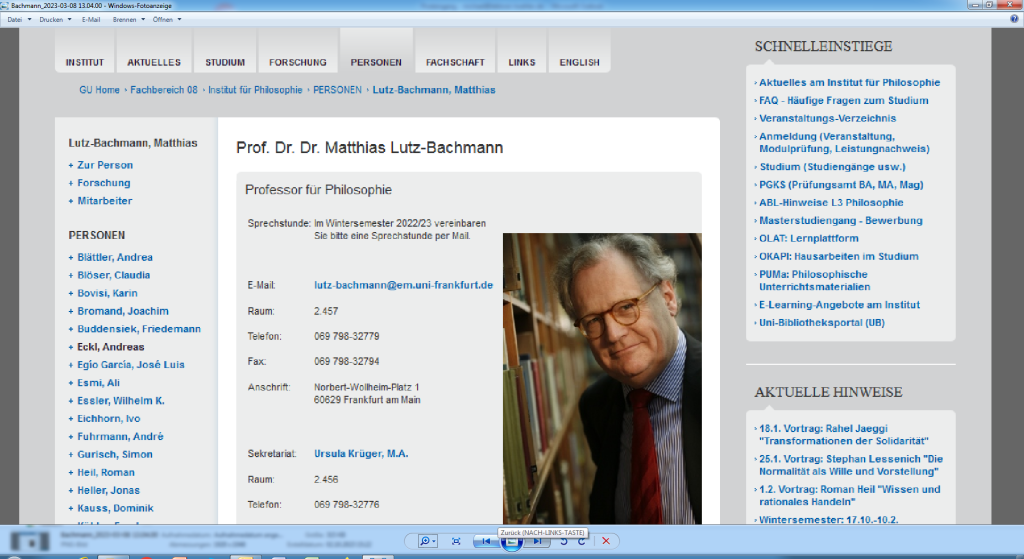
Die Seite Matthias Lutz-Bachmanns innerhalb des Webauftritts der Goethe-Universität im Jahr 2023
Nach seiner Emeritierung wirkt Lutz-Bachmann als „Distinguished Professor“ auf seiner alten Stelle weiter. Die erste Zeit in Frankfurt arbeitete er noch mit Schmidt zusammen auf demselben Lehrstuhl, die Beziehung zu ihm war immer sehr eng; nach einer schweren Herzoperation in der Frankfurter Universitätsklinik zwei Tage vor Schmidts Tod sprach Lutz-Bachmann noch mit ihm.[11] Dass beide zusammen auf dem Foto Barbara Klemms an der Bockenheimer Warte zu sehen sind, wird im Wikipedia-Porträt Lutz-Bachmanns unter „Trivia“ abgehandelt.[12]
Gern hätten die Stadtteil-Historiker auch mehr über die Studentin erfahren, die vor der Tafel im Raum 4 des Philosophischen Seminars links neben Alfred Schmidt sitzt. Bis zum Tag der ersten Veröffentlichung unserer Projektdokumentation waren unsere Recherchen aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Wir hoffen, dass wir hier eines Tages mit unserem „work in progress“ weiterkommen.
[1] Vgl. Andreas Meier, Die Universität, Frankfurt am Main 2020, S. 38 ff.
[2] Vgl. zu den Seminaren Apels in den 1980er Jahren die Vorlesungsverzeichnisse der Goethe-Universität für die Sommersemester bis 1989 unter https://www.uni-frankfurt.de/39282519/Best%C3%A4nde, Zugriff am 9.7.2024.
[3] Mündlicher Bericht Barbara Klemm vom 18.4.2024. Mit dem Auftrag für die Fotos zur Ausstattung des U-Bahnhofs Bockenheimer Warte war der Besuch nicht verbunden; er wurde erst Ende 1984, Anfang 1985 erteilt.
[4] Mündlicher Bericht Matthias Lutz-Bachmann vom 13.3.2023.
[5] Vgl. https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11102/file/1979sv.pdf, S. 54, Zugriff am 8.7.2024.
[6] Mündlicher Bericht Matthias Lutz-Bachmann vom 13.3.2023.
[7] Vgl. die unter https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/17036/start/0/rows/100/sortfield/year/sortorder/desc archivierten Vorlesungsverzeichnisse der Goethe-Universität für Wintersemester 1978/79, Sommersemester 1979, Wintersemester 1979/80 und Sommersemester 1980.
[8] Vgl. https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4444, Zugriff am 10.7.2024.
[9] Vgl. Alfred Schmidt, Marx als Philosoph, Springe 2018, Nachwort von Reinicke S. 179 ff., die Passage zu dem „geheimen Buchladen“ auf S. 197.
[10] Vgl. https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/11094/file/1983sv.pdf , S. 58, Zugriff am 10.7.2024.
[11] Mündlicher Bericht Matthias Lutz-Bachmann vom 13.3.2023. Vgl. auch https://www.uni-frankfurt.de/44527453/Zur_Person, Zugriff am 10.7.2024.
[12] Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Lutz-Bachmann, Zugriff am 10.7.2024.